

Wenn nicht mit Rap, dann mit dem Drumherum: wie Jay-Z (offiziell wieder mit Bindestrich, aber in Großbuchstaben: JAY-Z) das Rapgeschäft als Sprungbrett zu noch weitaus größerem Business genutzt hat, wie er gleichzeitig Dauerthema in der Gala und universeller GOAT-Anwärter sein kann und wie immer noch alle die Ohren spitzen, wenn er irgendwo acht bis sechzehn droppt – das hat sonst niemand so hingekriegt. Jetzt der Zirkelschluss. Mit Soloalbum 13 und Produzent No I.D. an den Boards geht es musikalisch zurück in die Gefilde des 21 Jahre lang gereiften »Reasonable Doubt«, während Jay-Z inhaltlich dem Privatmann Shawn Carter so nahe kommt wie schon lange nicht mehr. Beziehungsbeichten und … und was eigentlich?
Mit 36 Minuten ist »4:44« ohnehin nicht besonders lang, aber es sind gerade einmal zwei Zeilen, über die es die hitzigsten Diskussionen gibt, seit das Album Ende Juni erschienen ist. Die Zeilen lauten: »You wanna know what’s more important than throwin’ away money at a strip club? Credit/You ever wonder why Jewish people own all the property in America? This how they did it.« Die eine, mehr als legitime Abzweigung wäre an dieser Stelle, sich vier Seiten lang kritisch mit Antisemitismus in Rap und Gesellschaft zu befassen. Die andere Abzweigung – und, Spoiler, die nehmen wir – führt aber viel direkter zu Jay-Z, seinem Weltbild und dem nicht selten widersprüchlichen Wertesystem, das hinter diesen zwei Zeilen ebenso steckt wie hinter großen Teilen seines Schaffens. Was treibt ihn an, den Multimillionär und Vorzeige-HipHop-Entrepreneur aus Brooklyn?
Sprechen wir über Geld. Schließlich ist das alte Tellerwäscher-(respektive Dealer)-zum-Millionär-Narrativ, der Aufstieg von der Straßenecke ins Eckbüro, schon seit »Reasonable Doubt« omnipräsent in den Texten des Jiggaman, der das Plusmachen allerspätestens mit »I’m not a businessman, I’m a business, man« zum Überslogan erhoben hat. Keine Frage, Jay-Z verweist auf das so uralte wie hässliche Klischee vom reichen, gierigen Juden. Dem gegenüber steht, ähnlich unschön, der triebgesteuerte Afroamerikaner, der nie auf die Idee käme, dass im Stripclub geworfene Dollarnoten kein gutes Investment sind. Beides ist hart überzeichnet, bewusst dramatisiert und dient einer zentralen Aussage: Die schwarze Community nutzt nicht alle Chancen, ist wirtschaftlich nicht zielstrebig genug. Schwarzes Empowerment geht bei Jay-Z immer Hand in Hand mit dem Aufbau wirtschaftlicher Macht. »The Story Of O.J.«, der Track, aus dem diese Zeilen stammen, lebt von dieser Maxime. In der ersten Strophe ermutigt er den Ticker aus der Hood dazu, seine Einnahmen in Immobilien in der Nachbarschaft zu stecken, halb Geldwäsche, halb Investition in die eigene Umgebung. Dann ärgert er sich, vermeintlich nur als lässige Anekdote: »I coulda bought a place in Dumbo before it was Dumbo for like 2 million/That same building today is worth 25 million«. Ärgerlich, klar. Aber schon hier zeigt das moralische Fundament des Shawn Carter kleine Risse.
We gon’ start a society within a society
Dumbo – kurz für Down Under The Manhattan Bridge Overpass – ist ein ehemals marodes Industrie- und Hafengebiet in Brooklyn, das in den Siebzigern wegen leerstehender günstiger Fabriklofts von Künstlern entdeckt und seitdem gründlich durchgentrifiziert wurde, nachdem ein Investor mal eben den kompletten Stadtteil kaufte und, na ja, aufwertete. Heute zählt Dumbo zu den teuersten Vierteln New Yorks, und mit einem smarten Investment hätte Jay-Z ordentlich davon profitieren können – ein Prozess, den man in Brooklyn und Harlem immer wieder erlebt hat, und unter dem die Ärmsten am meisten zu leiden haben, die sich ihre eigene Nachbarschaft nicht mehr leisten können. Aber um diese Gruppen von Gentrifizierungsverlierern geht es ihm nie, sondern um den Einzelnen, der gefälligst für seinen Mikrokosmos die besten, profitabelsten Entscheidungen treffen soll. Das ist so pragmatisch wie egoistisch: Hey, das kaputte System können wir nicht ändern. Also lasst es wenigstens zu unseren Gunsten nutzen.
Auf dieser Grundlage kann er auch übergehen, dass Drogen vielleicht gar nicht für alle in der Verwertungskette so cool sind, obwohl seine Heimat Bed-Stuy von der Crack-Epidemie einst überdeutlich gezeichnet war. So wie schon das Startkapital für Roc-A-Fella Records teilweise von der Straße kam, geht es auch in »O.J.« nicht um das Woher, sondern das Wohin des Geldes. »The Story Of O.J.«, sagt er zum Release, »handelt von uns als Kultur, die einen Plan hat, um voranzukommen. Wenn man Erfolg hat, muss man daraus etwas Größeres machen.« Was er nicht sagt: Das Wir ist bei ihm fast immer ein Ich. Wo Gewinner sind, sind auch Verlierer, man muss nur zusehen, auf der richtigen Seite zu landen. Das Gewinnen durch kalkuliertes Handeln ist es wohl, was Afroamerikaner von Juden lernen können, wenn es nach Jay-Z geht. In seiner Autobiografie ordnet er schon ganz naheliegend ein: »Wenn ich solche Lines schreibe, setze ich voraus, dass man mich und meine Intentionen kennt und weiß, dass ich kein Antisemit oder Rassist bin, selbst wenn ich Stereotype in meinen Texten verwende.« Referenzen aus dem Judentum sind positiv aufgeladen, um Erfolg zu illustrieren: »Rich niggas, black Bar Mitzvahs/Mazel tov, it’s a celebration bitches, L’chaim!« kann seit 2007 jeder mitsingen, und auch der Kosename (Jay) Hova kommt aus dem Hebräischen. Die jüdische Anti-Defamation League unterstellt Jay-Z auch im jüngsten Fall keine böse Gesinnung – klare Kritik für das erneute Aufgreifen dieser Stereotype hagelt es trotzdem zu Recht.
I take what’s mine, you accept what they give you, I get you
Wie er dann in der zweiten Strophe über die Wertsteigerung seiner zu vererbenden Kunstsammlung spricht, passt perfekt zum Grundton des Albums. Im Vergleich zum jüngeren Jay-Z, der Reichtum genretypisch als etwas verstanden hat, womit es andere zu beeindrucken gilt, und dieses Konzept mit Kanye auf »Watch The Throne« auf die Spitze der Dekadenz getrieben hat, klingt Jay-Z mit inzwischen 47 Jahren über weite Strecken so nüchtern, wie man in seiner Situation nur klingen kann. Über Millionensummen, Luxuskarren und Kunstsammlerei rappt er mit der Unaufgeregtheit eines Bausparers, nur halt zwei Nummern größer; nicht um anzugeben, sondern weil es nun mal Dinge sind, die ihn ehrlich beschäftigen. Das mag auf die paar Nichtmillionäre, die sein Album hören, schon mal befremdlich wirken, aber es gibt nur den einen Antrieb: »Financial freedom my only hope/Fuck living rich and dying broke«.
Dass in dieser Zeile von Hoffnung die Rede ist, ist entweder dem Reim geschuldet oder lässt tief blicken. Es ist zumindest schwer vorstellbar, dass Jay-Z immer noch keine finanzielle Sicherheit empfindet. Im Mai hat das Forbes Magazin sein Vermögen auf stolze 810 Millionen Dollar geschätzt, in den »Forbes Five« der reichsten HipHop-Künstler liegt er damit auf dem zweiten Platz, hauchdünn hinter Sean »Diddy« Combs mit 820 Millionen. Ein nicht unwesentlicher Teil dieser 810 Millionen dürfte auf seine Anteile an einem Unternehmen entfallen, das Jay-Z Anfang 2015 für 56 Millionen Dollar gekauft hat und das zuletzt mit rund 600 Millionen bewertet wurde: Tidal. Dabei sind die Zahlen des Streamingdienstes gar nicht so berauschend und auch ein wenig nebulös. Immer wieder ist die Rede von geschönten Abonnentenzahlen, zur Zeit gehen realistische Schätzungen von drei Millionen zahlenden Kunden aus – mager im Vergleich zu Spotify (50 Millionen) oder Apple Music (27 Millionen). Tidal präsentiert sich gern als der künstlerfreundlichste – weil in Künstlerbesitz befindliche – Streamingdienst, sein wichtigstes Verkaufsargument für den Endverbraucher sind aber exklusive Veröffentlichungen von Superstars wie Rihanna, Beyoncé oder Kanye West. Ehrensache, dass Chef Carter auch sein jüngstes Album Ende Juni als Tidal-Exclusive vorstellt, bevor es im Juli bei anderen Anbietern verfügbar wird. (Nur beim Streaming-Marktführer Spotify fehlte »4:44« bei Redaktionsschluss Ende Juli noch, ebenso wie der komplette restliche Katalog von Jay-Z.)
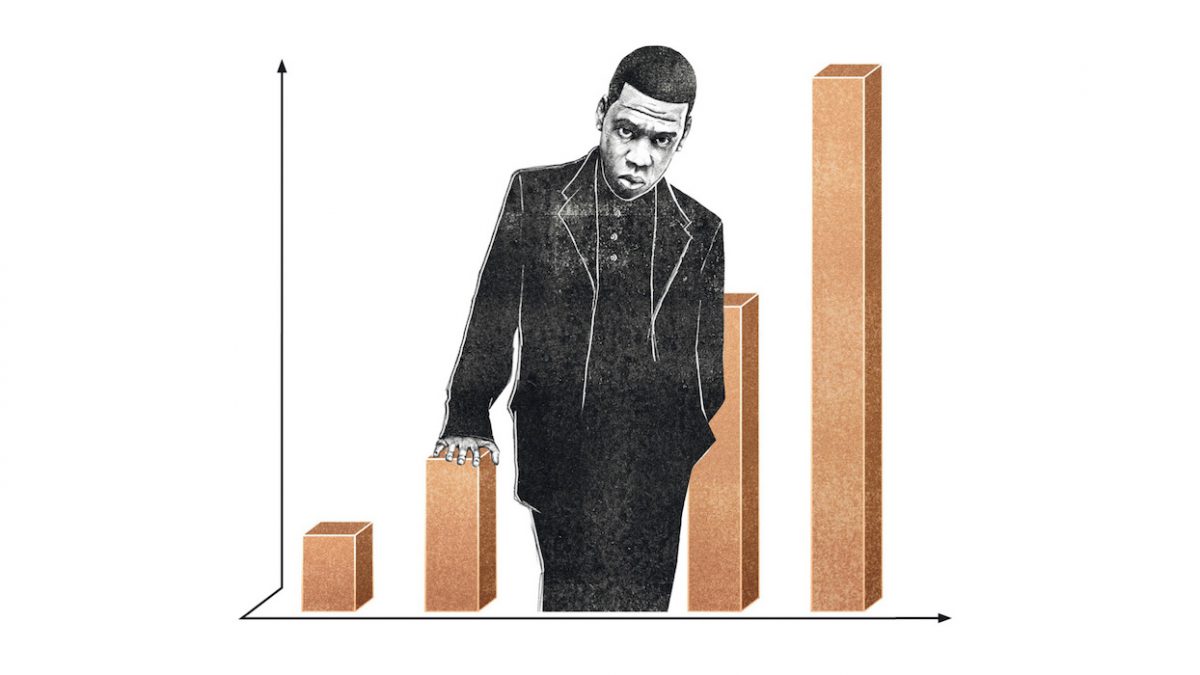
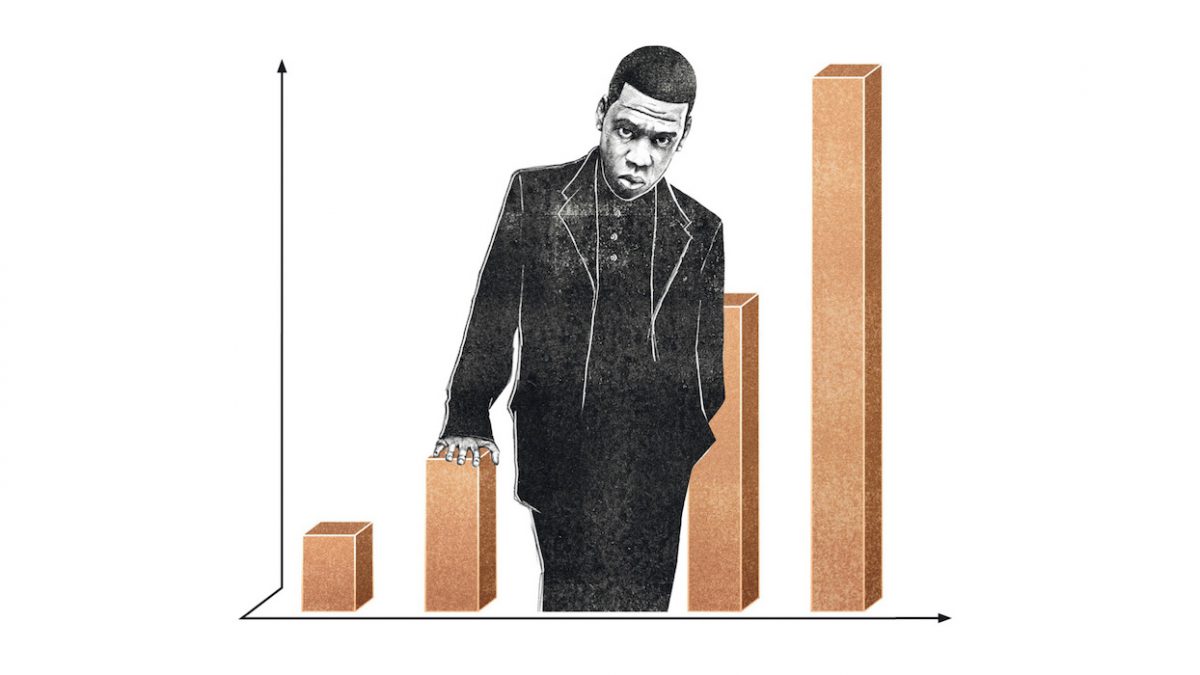
Don’t ever go with the flow, be the flow
Nach fünf Tagen wird »4:44« als 13. Jay-Z-Album in Folge in den USA mit Platin ausgezeichnet, wenn auch mit Tricks. Nach dortigen Bestimmungen gibt es Platin für eine Million abgesetzter Einheiten, 1.500 einzelne Song-Streams zählen als eine Verkaufseinheit. Das Album mit seinen zehn Songs hätte also als Tidal-Exclusive 150 Millionen mal ganz gestreamt werden müssen, um Platin zu gehen, rund fünfzig Mal pro Abonnent. Um die Sache zu beschleunigen, kauft Mobilfunkanbieter Sprint – seit Januar Besitzer eines Drittels von Tidal – kurzerhand eine Million Albumdownloads von Tidal und verschenkt diese weiter, laut Regelwerk ein legitimer Weg zu Platin. So bizarr der Deal auch anmutet, wir könnten so etwas in Zukunft häufiger erleben: Mit dem 200 Millionen Dollar teuren Einstieg von Sprint soll auch ein jährliches Marketingbudget von 75 Millionen für exklusive Releases und das Drumherum eingeführt worden sein. Ob das reicht, um Tidal langfristig eine profitable Rolle im Streamingmarkt zu sichern, oder ob Hov und seine Miteigner die restlichen zwei Drittel des Ladens einfach zu Geld machen, wird die Zeit zeigen. Natürlich lässt Jay-Z keine Gelegenheit aus, Tidal enthusiastisch zu promoten. Man erinnert sich an das surreale Launch-Event von Tidal, als ein bunter Haufen Superreicher von Alicia Keys bis Madonna sich darüber beschweren durfte, woanders nicht genug Geld für Streams zu bekommen – keine unwichtige Botschaft, aber so manchem mittelständischen Musiker mit etwas existenzielleren Problemen dürfte dabei trotzdem das Lachen vergangen sein. Das große Tidal-Exclusive ist eben doch nur für ein paar Handvoll Musiker eine Marketingoption.
Tidal ist nur ein Beispiel, an dem man merkt, wie weit Jay-Z sich vom Fußvolk entfernt hat, sich ihm aber immer noch verbunden fühlt. Skip zu »Family Feud«: »Fuck rap, crack cocaine/Nah, we did that, black-owned things/Hundred percent, black-owned champagne«. Da ist er: der Schampus. Armand de Brignac gehört Jay-Z seit 2014 und wird von ihm schon 2006 propagiert, nachdem der Produzent des Konkurrenzprodukts Cristal sich vom Zuspruch der HipHop-Bling-Gesellschaft distanziert. Die günstigste Flasche Armand kostet heute an die 300 Euro, und es verwundert nicht, dass der Schaumwein regelmäßig Erwähnung in Jay-Zs Texten findet, in »Family Feud« aber nicht nur als Statussymbol, sondern explizit als Marke in schwarzem Besitz. Das wirft ein paar Fragen auf. Ist es gerechtfertigt, Shawn Carters Luxus-Schampus prinzipiell mit dem familiengeführten Corner Store in Bed-Stuy gleichzusetzen – Hauptsache »black-owned«? Wie treffend ist es, wenn er in »Legacy« die heutige Situation schwarzer Technologie-Unternehmen (zu denen er irgendwie auch Tidal zählen muss) mit dem Ausschluss schwarzer Spieler aus dem Profi-Baseball Ende des 19. Jahrhunderts vergleicht? Und wenn er abschätzig sagt: »Y’all still drinkin’ Perrier-Jouët, hah«, mit welchen uncoolen Midprice-Champagner-Trinkern spricht er dann? Vielleicht ist das eine Motivationstechnik. Vielleicht aber auch eine tiefe argumentative Verstrickung von Hautfarbe und Kapitalismus, die er selbst nicht mehr ganz durchschaut und die in diesem Zuspruch gipfelt: »What’s better than one billionaire? Two/’Specially if they’re from the same hue as you«. Da geht es weder um Sicherheit und Freiheit noch um schwarzes Empowerment, sondern um den egoistischen Wunsch, bestenfalls kurz vor Diddy der erste Milliardär der Forbes Five zu werden.
Generational wealth, that’s the key
Jay-Z geht es auch auf »4:44« nicht primär um Umverteilung, Gerechtigkeit und gesellschaftliche Veränderung. Er predigt innerhalb eines desolaten Systems einen afrozentrischen Wirtschaftsdarwinismus, der aus der Gewinnerperspektive, zwanzig Jahre nach dem ersten Millionendeal, sicher einfacher aussieht als von der Straße aus. Seine Karriere ist beeindruckend, taugt aber nicht als skalierbares Mittel gegen ökonomische Ungerechtigkeit und strukturellen Rassismus. Ebenso wenig ist er als Tidal-Macher der wohltätige Robin Hood des unterrepräsentierten Künstlers, den er gerne mimt. Ja, pro Stream zahlt Tidal besser als die Marktführer. Aber die richtig großen Deals bekommt nur, wer schon die Marktmacht eines Weltstars hat. Und je mehr Anteile des Unternehmens verkauft werden, desto widersprüchlicher wird es, auf seinem besten Release seit dem »Black Album« tief ins Privatleben einzutauchen und »black-owned business« zu propagieren, während daran ein Telefonriese verdient, für den sich gerade die Deutsche Telekom interessiert. Jay-Zs jüngste Unternehmungen sind Beteiligungen an einem Risikokapital-Fonds und einem Startup-Inkubator, vermeldet die Wirtschaftspresse. Gut möglich, dass da der nächste große Fang auf dem Weg zur Milliarde wartet, und irgendwie würde man es ihm ja sogar gönnen – Real Rap.
Text: Ralf Theil
Illustration: Christian Wegerich
Dieses Feature erschien erstmals in unserer aktuellen Ausgabe. Jetzt am Kiosk oder JUICE #182 hier versandkostenfrei bestellen. 


