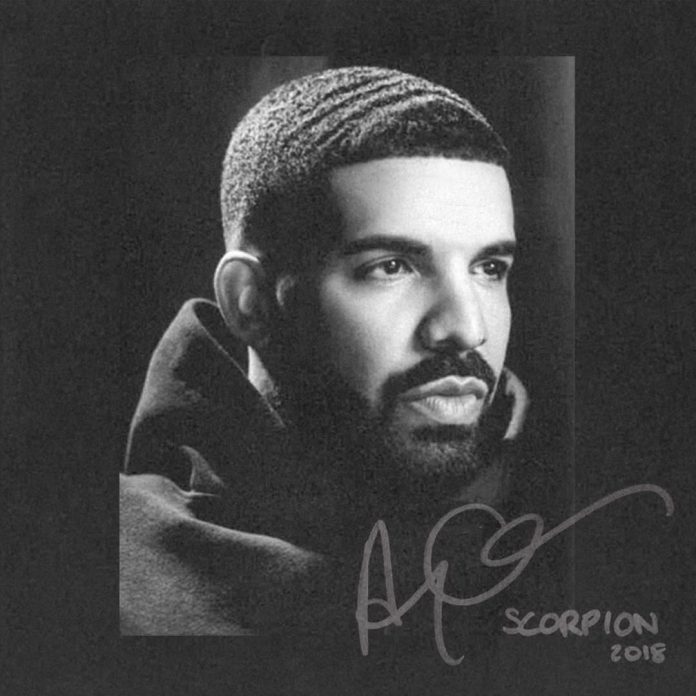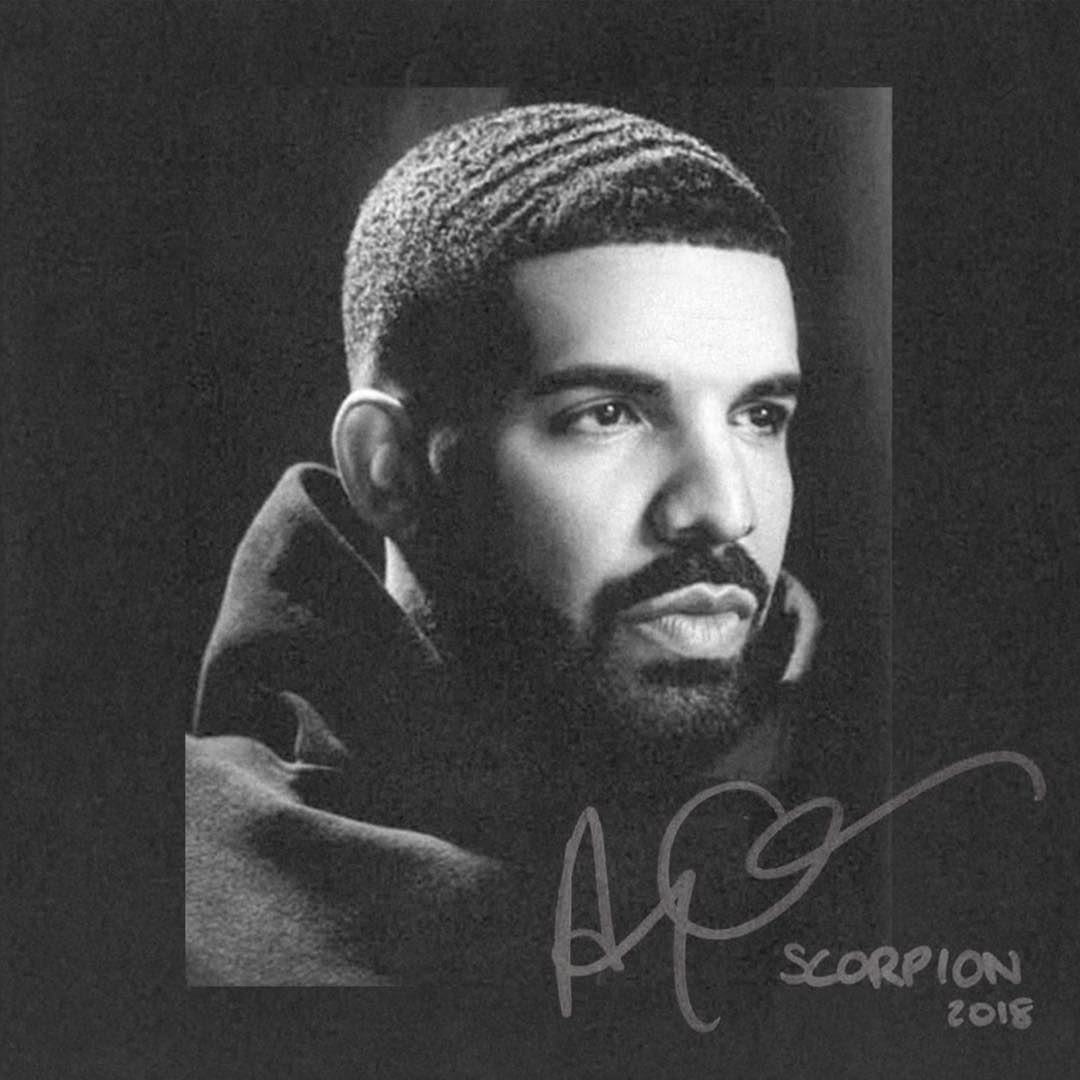
Republic/Universal
PRO
![]() Scheiße, ja, das Ding ist zu lang. Vielleicht ein Resultat von Drakes überbordendem Eifer, der aus der Ausgangslage vor dem Album resultierte: Pusha Ts »The Story Of Adidon« drängte Drizzy dermaßen in die Defensive, dass dieser sich mit 31 Jahren und seinem fünften Studioalbum erstmals mit dem Rücken zur Wand sah. Als müsse er sich erklären, geht es auf »Scorpion« viel um seine Rolle als Vater, der er scheinbar immer noch mit ambivalenten Gefühlen gegenübersteht, in Teilen jedoch erstaunlich direkt adressiert: »Single father, I hate when I hear it/I used to challenge my parents on every album/Now I’m embarrassed to tell ‘em I ended up as a co-parent«. Die Vaterschaftsthematik zieht sich durch das ganze Album und kulminiert im Track »Emotionless«, wo sich Drizzy über die toxische Internetkultur auslässt und auf Pushas Versteckspiel-Vorwürfe antwortet. Ansonsten: überbordende Selbstverliebtheit, narzisstischer Mitteilungsdrang, classic Drake. Das kann man als künstlerische Stagnation ansehen, aber dann hat man Drake nie wirklich verstanden. Hier geht es längst nicht mehr um Innovation oder Hits, sondern darum, was als Nächstes passiert. Sein zugegebenermaßen etwas problematischer Patois-Grind oder seine Adaption von südstaatlichem Braggadocio-Swagger – auf den ersten Blick kulturelle Aneignung in Reinform. Auch »Look Alive« war erstmal ein cleverer Marketing-Move, gleichzeitig aber katapultierte er einen weitgehend unbekannten Streetrapper in ungeahnte Höhen. Drakes Subgenre-Ausflüge sind kein verzweifeltes Anbiedern, sondern intelligente Erweiterungen der Facetten seiner Künstlerperson, weil sie gut umgesetzt werden. Überall finden sich auf »Scorpion« starke Momente: »8 Out Of 10«, für den sich Boi-1da in Just Blaze verwandelt und ein Streicher-Loop schustert, auf dem in bester Drizzy-Manier der eigene Status quo beleuchtet wird, »Peak«, in etwa »Marvin’s Room« in der 2018-Version oder »Don’t Matter To Me« mit unveröffentlichten Michael-Jackson-Vocals (!). »Scorpion« ist ein ausgewogenes Konglomerat aus organischem Sample-Kram der »No Room For Improvement«-Zeiten, dem Trademark-Sound vom karrieredefinierenden »Take Care« und zeitgeistigen Trap-Produktionen. Drake liefert Soundtracks für Lebensabschnitte, die unweigerlich Assoziationen hervorrufen, weil sie so verdammt eingängig und relatable sind. So war es bei jedem Drake-Album. Und so wird es auch bei »Scorpion« sein.
Scheiße, ja, das Ding ist zu lang. Vielleicht ein Resultat von Drakes überbordendem Eifer, der aus der Ausgangslage vor dem Album resultierte: Pusha Ts »The Story Of Adidon« drängte Drizzy dermaßen in die Defensive, dass dieser sich mit 31 Jahren und seinem fünften Studioalbum erstmals mit dem Rücken zur Wand sah. Als müsse er sich erklären, geht es auf »Scorpion« viel um seine Rolle als Vater, der er scheinbar immer noch mit ambivalenten Gefühlen gegenübersteht, in Teilen jedoch erstaunlich direkt adressiert: »Single father, I hate when I hear it/I used to challenge my parents on every album/Now I’m embarrassed to tell ‘em I ended up as a co-parent«. Die Vaterschaftsthematik zieht sich durch das ganze Album und kulminiert im Track »Emotionless«, wo sich Drizzy über die toxische Internetkultur auslässt und auf Pushas Versteckspiel-Vorwürfe antwortet. Ansonsten: überbordende Selbstverliebtheit, narzisstischer Mitteilungsdrang, classic Drake. Das kann man als künstlerische Stagnation ansehen, aber dann hat man Drake nie wirklich verstanden. Hier geht es längst nicht mehr um Innovation oder Hits, sondern darum, was als Nächstes passiert. Sein zugegebenermaßen etwas problematischer Patois-Grind oder seine Adaption von südstaatlichem Braggadocio-Swagger – auf den ersten Blick kulturelle Aneignung in Reinform. Auch »Look Alive« war erstmal ein cleverer Marketing-Move, gleichzeitig aber katapultierte er einen weitgehend unbekannten Streetrapper in ungeahnte Höhen. Drakes Subgenre-Ausflüge sind kein verzweifeltes Anbiedern, sondern intelligente Erweiterungen der Facetten seiner Künstlerperson, weil sie gut umgesetzt werden. Überall finden sich auf »Scorpion« starke Momente: »8 Out Of 10«, für den sich Boi-1da in Just Blaze verwandelt und ein Streicher-Loop schustert, auf dem in bester Drizzy-Manier der eigene Status quo beleuchtet wird, »Peak«, in etwa »Marvin’s Room« in der 2018-Version oder »Don’t Matter To Me« mit unveröffentlichten Michael-Jackson-Vocals (!). »Scorpion« ist ein ausgewogenes Konglomerat aus organischem Sample-Kram der »No Room For Improvement«-Zeiten, dem Trademark-Sound vom karrieredefinierenden »Take Care« und zeitgeistigen Trap-Produktionen. Drake liefert Soundtracks für Lebensabschnitte, die unweigerlich Assoziationen hervorrufen, weil sie so verdammt eingängig und relatable sind. So war es bei jedem Drake-Album. Und so wird es auch bei »Scorpion« sein.
Text: Juri Andresen
CONTRA
![]() Man muss es ja nicht übertreiben – oder scheinbar doch. Denn die als »Scorpion SZN« betitelte Marketingkampagne, die Spotify anlässlich Drakes fünftem Soloalbum veranstaltete, bepflasterte selbst Playlisten mit Drizzys Visage, die überhaupt keine Musik vom 6 God enthielten. Schlimmer noch: Listen mit Genreschwerpunkten wie »Ambient Chill«, »Indie Party« oder »Fresh Gospel« wurden mit Musik von Aubrey Graham verwässert. Derart aggressives Marketing hatte variierende Effekte: Der Kanadier hält nun wieder eine Vielzahl an Streaming- und Chartrekorden, andererseits durfte sich der schwedische Streaming-Riese über empörte Kunden freuen, die aufgrund des Drake-Überangebots ihr Geld zurückforderten. Apropos zu viel des Guten: Nachdem das ausufernde »Views« 2016 eher durchwachsene Kritiken erhalten hatte, kommt »Scorpion« als Doppelalbum mit 25 Tracks wie der musikgewordene Doppelwhopper daher. Das mag zunächst verlockend klingen, und die raplastige A-Seite schmeckt dank Bangern wie »Nonstop«, »God’s Plan« und »Mob Ties« auf Anhieb. Aber letzten Endes kommt es, wie es kommen muss: Mehr als anderthalb Stunden »Scorpion« lassen einen übersättigt zurück. Da hilft auch nicht, dass man tief für bisher unveröffentlichte Tonspuren von Michael Jackson in die Tasche gegriffen hat oder Jay-Z, dessen Verhältnis zum OVO-Mastermind über die Jahre ambivalent geblieben ist, auf »Talk Up« einen erstklassigen Gastverse kickt. Warum »Scorpion« mit derart viel Füllmaterial aufwartet, befeuerte im Netz wildeste Theorien. Die Plausibelste fußt auf der Line »Soon as this album drop, I’m out of the deal« aus »Is There More«. Rapfans rund um den Erdball verstehen das als offensichtlichen Verweis darauf, dass Drakes Tage als Cash-Money-Signee nun gezählt sind und nur ein Doppelalbum die noch verbleibenden Vertragsverpflichtungen erfüllen konnte. All den Kritikpunkten zum Trotz: »Scorpion« ist eine verhältnismäßig okaye Werkschau, die nur Meckern auf hohem Niveau zulässt. Davon zeugen die drei bislang veröffentlichten Nummer-eins-Hits sowie ein knappes Dutzend weiterer guter Songs. Was man in Drakes Katalog seit »If You’re Reading This…« jedoch vermisst: Stringenz und damit einhergehend den unbedingten Willen (auch seitens Noah »40« Shebib), ein dramaturgisch rundes Gesamtwerk zu schaffen. Einen Klassiker misst man schließlich nicht in Playlisten-Covern.
Man muss es ja nicht übertreiben – oder scheinbar doch. Denn die als »Scorpion SZN« betitelte Marketingkampagne, die Spotify anlässlich Drakes fünftem Soloalbum veranstaltete, bepflasterte selbst Playlisten mit Drizzys Visage, die überhaupt keine Musik vom 6 God enthielten. Schlimmer noch: Listen mit Genreschwerpunkten wie »Ambient Chill«, »Indie Party« oder »Fresh Gospel« wurden mit Musik von Aubrey Graham verwässert. Derart aggressives Marketing hatte variierende Effekte: Der Kanadier hält nun wieder eine Vielzahl an Streaming- und Chartrekorden, andererseits durfte sich der schwedische Streaming-Riese über empörte Kunden freuen, die aufgrund des Drake-Überangebots ihr Geld zurückforderten. Apropos zu viel des Guten: Nachdem das ausufernde »Views« 2016 eher durchwachsene Kritiken erhalten hatte, kommt »Scorpion« als Doppelalbum mit 25 Tracks wie der musikgewordene Doppelwhopper daher. Das mag zunächst verlockend klingen, und die raplastige A-Seite schmeckt dank Bangern wie »Nonstop«, »God’s Plan« und »Mob Ties« auf Anhieb. Aber letzten Endes kommt es, wie es kommen muss: Mehr als anderthalb Stunden »Scorpion« lassen einen übersättigt zurück. Da hilft auch nicht, dass man tief für bisher unveröffentlichte Tonspuren von Michael Jackson in die Tasche gegriffen hat oder Jay-Z, dessen Verhältnis zum OVO-Mastermind über die Jahre ambivalent geblieben ist, auf »Talk Up« einen erstklassigen Gastverse kickt. Warum »Scorpion« mit derart viel Füllmaterial aufwartet, befeuerte im Netz wildeste Theorien. Die Plausibelste fußt auf der Line »Soon as this album drop, I’m out of the deal« aus »Is There More«. Rapfans rund um den Erdball verstehen das als offensichtlichen Verweis darauf, dass Drakes Tage als Cash-Money-Signee nun gezählt sind und nur ein Doppelalbum die noch verbleibenden Vertragsverpflichtungen erfüllen konnte. All den Kritikpunkten zum Trotz: »Scorpion« ist eine verhältnismäßig okaye Werkschau, die nur Meckern auf hohem Niveau zulässt. Davon zeugen die drei bislang veröffentlichten Nummer-eins-Hits sowie ein knappes Dutzend weiterer guter Songs. Was man in Drakes Katalog seit »If You’re Reading This…« jedoch vermisst: Stringenz und damit einhergehend den unbedingten Willen (auch seitens Noah »40« Shebib), ein dramaturgisch rundes Gesamtwerk zu schaffen. Einen Klassiker misst man schließlich nicht in Playlisten-Covern.
Text: Jakob Paur