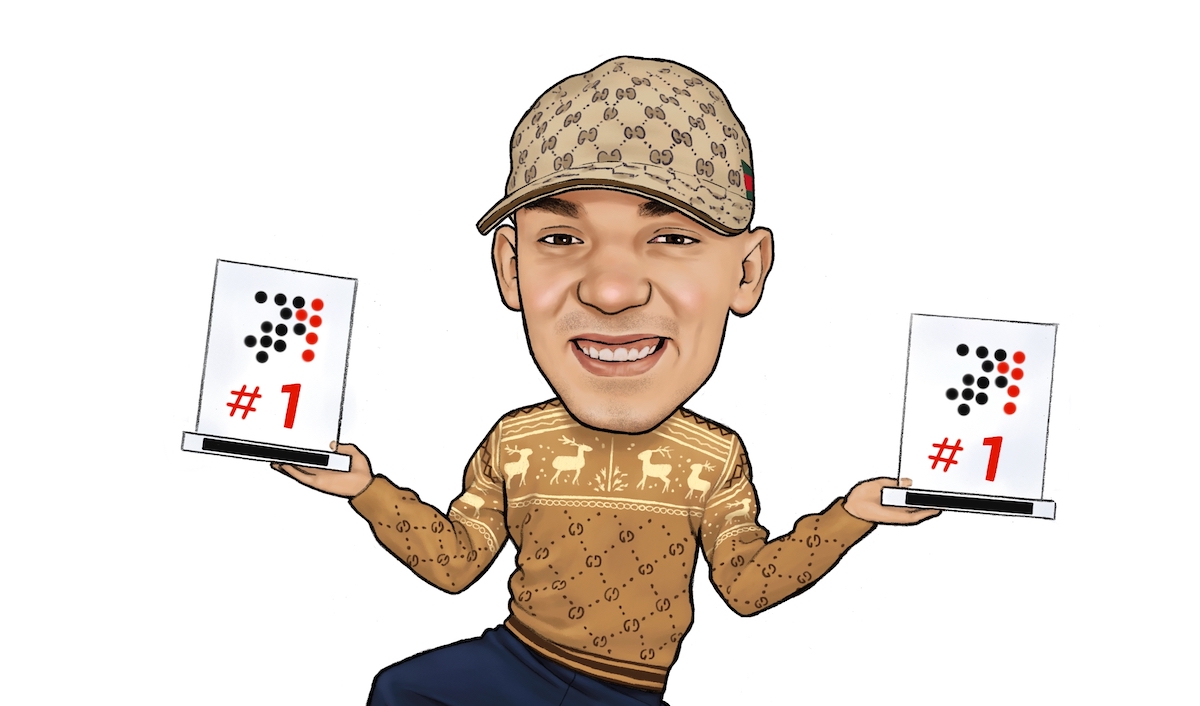
Streaming – eine größere technische Entwicklung als diese Form der Digitalisierung hat die Musikindustrie wohl seit der Erfindung des Grammophons nicht mehr mitmachen müssen. Spotify & Co. ermöglichen uns legalen Zugang zu unendlich viel Musik – kostenlos oder im unkomplizierten Flatrate-Modell. Diese eigentlich traumhafte Entwicklung birgt allerdings auch Probleme. Ein Blick auf die andere Seite der Medaille.
Die Musikindustrie ist eine Katze, die immer auf ihren Füßen landet. Man erinnere sich nur an die große Piraterie-Krise der 2000er. Der vermeintliche Untergang bahnte sich schon Mitte der 90er in Form der mp3 an. Als die apokalyptischen Reiter Napster, Limewire, Kazaa und eDonkey2000 am Horizont erschienen, wähnte die gesamte Musikindustrie sich panisch dem Ende nahe. Im Jahr 2000 brachen die Umsätze der deutschen Musikbranche tatsächlich dramatisch ein, das mag aber auch dem Rekordhoch geschuldet sein, auf dem die Zahlen sich Mitte der Neunziger befanden. Rückblickend nicht mehr als eine Blase. Kleines Wirtschaftseinmaleins. Nichts Besonderes. Die Umsätze in Deutschland pendelten sich schnell wieder auf dem Niveau der frühen Neunziger ein und verhalten sich seither konstant. Mit kleineren Schwankungen scheffelt die deutsche Musikindustrie jährlich etwa 1,5 Milliarden Euro. Das hinderte die führenden Köpfe aber nicht, sich wenig später erneut in Lebensgefahr zu wähnen. Diesmal war ein Phänomen namens Musikstreaming der Grund für die Aufregung.
Zwar war niemand gezwungen mitzuspielen, dennoch stellten alle munter ihre Werke zur Verfügung, während sie an anderer Front jammerten, dass die monetäre Ausschüttung seitens der Anbieter, allen voran Spotify, viel zu gering ausfallen würde. Einerseits machte man sich also zum Steigbügelhalter, weil man nicht auf sein Stück vom Kuchen verzichten wollte, andererseits malte man mal wieder den Teufel an die Wand. Bei den mickrigen Auszahlungen würden Musiker bald erbärmlich verhungern müssen, befürchtete man. Einen nicht unwesentlichen Anteil daran hatten allerdings auch veraltete Künstlerverträge, in denen die Onlineverwertung der Werke kaum geregelt war – in den Köpfen der Beteiligten stand noch immer der Vertrieb physischer Tonträger an der Ladentheke im Vordergrund.
Außerdem waren Streamingdienste, allen voran Spotify, wachsende Geschäftsmodelle, die sich eher in der Zukunft rentieren sollten. Dieses Jahr ging Spotify an die Börse und konnte dort alle Erwartungen übertreffen – dabei war das Fiskaljahr 2018 das erste seit der Gründung 2006, in dem Spotify überhaupt Gewinne erwirtschaften konnte. Man war bereit, zu investieren, schließlich wächst das Geschäft rasant – beim Videostreaming-Riesen Netflix ging dieselbe Strategie tadellos auf. Allerdings produziert Netflix auch eigene Inhalte. Spotify, Apple Music, Deezer und Konsorten sind vollständig von fremdem Content abhängig – ein Umstand, der Probleme birgt. 2018 wird Musikstreaming laut dem Halbjahresreport des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) voraussichtlich erstmals das anteilig umsatzstärkste Medium und drängt die CD, die 2017 noch die Krone trug, weiter vom Markt.
Spotify & Friends
Die Vormachtstellungen manifestieren sich. Spotify hielt im ersten Halbjahr 2018 einen Marktanteil von 36 Prozent, Apple Music folgt mit 19 Prozent weltweit. Über die Hälfte der gesamten Streaming-Landschaft gehört diesen beiden Firmen. In Deutschland hat Spotify die Nase sogar noch weiter vorne. Spotify and friends werden immer größer und einflussreicher. Das bedroht die ursprünglich Großen und Einflussreichen: die Major-Labels. Diese brauchen also Argumente auf der Habenseite. Sie benötigen genügend relevante Künstler, um Druck auf die Streaming-Anbieter ausüben zu können. Schließlich geht es am Ende immer darum, einen guten Deal auszuhandeln – und den kriegt man nicht, wenn man keine Druckmittel hat.
Die Signing-Wut, die die großen Labels und ihre Tochterfirmen 2018 an den Tag legten, fußt lediglich auf der Angst, kein Faustpfand in der Hinterhand zu haben, wenn Spotify plötzlich anfängt, Forderungen zu stellen. Im Grunde wird hier schlichtweg der Grundstein für Lobbyarbeit gelegt. Man will Forderungen stellen, statt welche zu erfüllen. Denn Labels und Künstler können ungemein davon profitieren, wenn sie in der Gunst der Dienste und Playlist-Kuratoren stehen. Eine prominente Platzierung kann ein unbeschreiblich wertvoller Multiplikator für ein Release sein. Hunderttausende Follower generieren Abermillionen von Abrufen und spülen den Künstlern so nicht nur jede Menge Kohle in die Taschen, sondern kurbeln nebenbei noch Chartplatzierungen und Auszeichnungen an – so sehr sogar, dass der BVMI die Wertigkeit für Streams bei der Verleihung von Edelmetallschallplatten dieses Jahr um die Hälfte reduzierte.
Als Rapper ist es wahnsinnig wichtig, in großen, von Spotify-Redakteuren kuratierten Playlisten wie dem Spitzenreiter »Modus Mio« oder dem berüchtigten »Shisha Club« stattzufinden. Und genau da liegt der Hund begraben: Diese Playlisten folgen stets einer bestimmten Ästhetik, meist einem einheitlichen Soundbild. Ist das erklärte Ziel für einen Rapper also ein Platz in einer solchen Playlist, biedert er sich ihrem Sound an. In den meisten Fällen heißt das: Afrikanisch beeinflusster Dance-Riddim, unbeflissen geträllerte Autotune-Hook und irgendein Feelgood-Thema, das eigentlich gar keines ist. So findet der x-te Afro-Trap-Song seinen Platz in der Playlist, wodurch sich deren Linie weiter verhärtet: ein Perpetuum mobile der seichten Sommerhits.
Auch jetzt, im tiefsten Winter, werden die Playlisten noch mit sonnig-luftigen MHD-Abziehbildchen geflutet. So klingen diese Listen nun mal, da ist kein Platz für Ausreißer. Die Eigenheiten, die das Streaming mit sich bringt, beeinflussen die Machart der Musik aber auch darüber hinaus. Schließlich wird hier nach Plays ausgezahlt. Also gilt es nicht nur, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Konsumenten das Album hören, sondern vor allem, dass möglichst viele Songs möglichst oft gehört werden. Das wird mit einem einfachen Trick forciert: Die Songs werden kürzer. Ein Blick in die aktuellen Playlisten zeigt, dass kaum ein Song noch eine Länge von drei Minuten oder mehr erreicht (zum Vergleich kann man mal einen Blick auf die Tracklisten großer Deutschrap-Klassiker werfen).
Tötet Streaming die Musikindustrie?
Der Grund für diese Stauchung ist schlichtweg ein rechnerischer: Der Hörer kann einem in einer halben Stunde mehr als zehn Plays bescheren, wenn die Songs nur kurz genug sind. Bei Tracks, die gerne mal viereinhalb Minuten in Anspruch nehmen, wie es einst gang und gäbe war, dauert das deutlich länger – vielleicht ist die Busfahrt, während der das Album gestreamt wird, sogar schon nach fünf Songs vorbei. Verschenktes Einkommen also. Besonders gerne wird heutzutage am Intro gespart. Statt dass der Beat zu Beginn eines Liedes erst mal großzügig herumdudelt, wird direkt in die Action eingestiegen – es darf auf keinen Fall langweilen! Denn wird ein Song übersprungen, bevor er mindestens 30 Sekunden lief, zahlt Spotify dem Künstler nichts für den Abruf aus. Der Aufbau eines Songs darf sich also keine Zeit lassen, damit möglichst viele Plays monetarisiert werden.
Während einzelne Anspielstationen möglichst komprimiert gehalten werden, zieht man das gesamte Album gerne mal ordentlich in die Länge. Auch hier sollte ein vergleichender Blick auf ältere Klassiker geworfen werden, die im Schnitt etwa zwölf Songs auf dem Tacho haben. In der Spieldauer waren sie zwar oft sogar länger, aber zwanzig oder mehr Songs sind heute keine Seltenheit mehr. In letzter Konsequenz sorgt Streaming beziehungsweise das Ausnutzen seiner Mechanismen vor allem für eines: Masse statt Klasse.
Regelmäßige Albumreleases, egal wie halbgar, spülen jedes Mal zuverlässig Geld in die Kasse – schließlich steht der Fan nicht einmal mehr vor einer Kaufentscheidung. So hat das altehrwürdige Albumformat eigentlich ausgedient. Single-Releases, die für Dauerrotation sorgen, sind 2018 mehr wert als solide Alben. Ein Album als Playlist zu konzipieren, wie es Ahzumjot und Teesy hierzulande bereits taten, scheint da noch ein recht progressiver Kompromiss zu sein.
Dass der freie und unkomplizierte Zugang zu einem schier endlosen Fundus an Musik etwas Wunderbares ist, steht außer Frage. Dass die Begleiterscheinungen der Musik in ihrer Souveränität massiv schaden, allerdings auch. Immerhin wurden auch nervige Promo-Beefs ausgemerzt – Parteiballungen und enge Fanbindung sind heutzutage deutlich weniger wert als Everybody’s Darling zu sein, als Gast in fremden Beliebtheitslisten aufzutauchen und nicht von Fans des Beef-Kontrahenten in Playlisten übersprungen zu werden. Außerdem traut sich der eine oder andere Rapper langsam an Releases, die nicht vorab von einer mehrmonatigen Promophase und dazugehöriger Buhlerei um Vorbestellungen begleitet werden. Das sind zwar nur kleine Trostpflaster, aber immerhin hat Streaming die Musikindustrie nicht getötet. Schon wieder nicht.
Text: Skinny
Illustration: Kanih Demir
Dieses Feature erschien in JUICE 190. Aktuelle und ältere Ausgaben könnt ihr versandkostenfrei im Onlineshop bestellen.


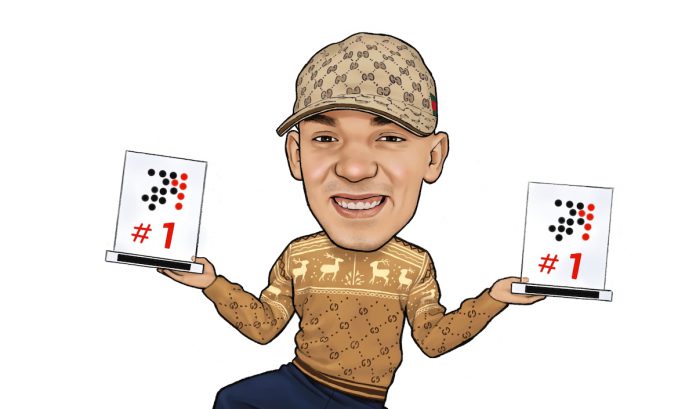

– Qualität wird sich immer durchsetzen egal in welchem Format.
– Das die Generationen nach uns erstmal mit gehen und vielleicht in ein paar Jahren verstehen was für zum Teil minderwertige Musik konsumiert wird, halte ich für sehr realistisch.
– Keiner nimmt dir was weg. Geh mit der Zeit. Take it or leave it.
Es zeigt doch aber wie Einfallsreich manch ein Kreativer ist um vorne mit zuspielen.
(Ich meine jetzt nicht die gleichen Drums zu nutzen, wie der Vorgänger um in der Liste MioMio ( oder heißt die so: „MiaoMiao“) zu landen.