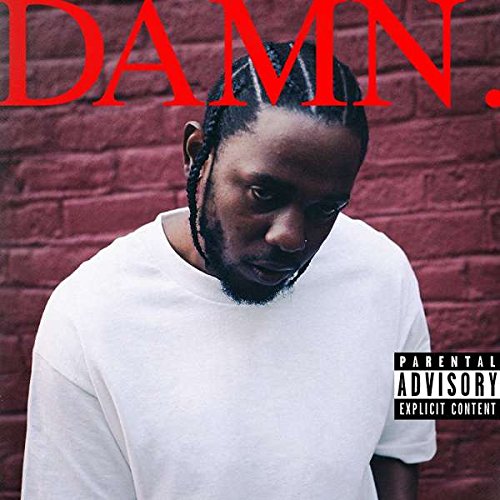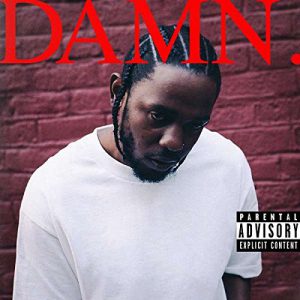
(Top Dawg Entertainment / Universal)
![]()
Wenn dein Zahnarzt dir bei der Wurzelbehandlung erzählt, dass das neue Drake-Album ja ganz nett sei, aber Kendrick Lamar eben der unbestreitbar größte Rapper seiner Zeit, dann ist die Sache eigentlich längst gelaufen. Völlig verdient katapultierte sich K-Dot mit seinem doppelten Opus »Good Kid, M.a.a.d. City« und »To Pimp A Butterfly« aus Compton in die letzten Ecken der westlichen Medienwelt. Doch nach all der feuilletonistischen Lobhudelei wollte man irgendwann einfach gar nichts mehr hören/sehen/lesen von diesem ach so unfassbaren Wunderkind, das allerorts zum Messias eines Genres berufen wurde. Und dann kam »DAMN.«. »DAMN.« ist – wie schon die Vorgänger – ein Album, mit dem sich Kendrick selbst definiert. Nur, dass es diesmal an die Wurzel geht. Nach dem lose autobiografischen Porträt einer Jugend in den gefährlichsten Bezirk von Los Angeles zog »TPAB« mit versammelter Mannschaft vors Weiße Haus; »Alright« verselbstständigte sich gar zum Protestsoundtrack. »DAMN.« knüpft an diese Erzählung an und beginnt mit einem Tarantino-Backdrop, in dem Kendrick einer erblindeten Dame zu Hilfe eilt – als Dank fängt er sich eine Kugel ein. Es folgt das Sample eines FOX-News-Sprechers, der Kendricks »Alright«-Performance bei den 2015er BET-Awards als moralischen Affront kommentiert. Und ab hier ziehen sich die Selbstzweifel als roter Faden durch »DAMN.«. Da wurde einer zum Hoffnungsträger auserkoren, aber: »Ain’t nobody praying for me«, stellt der resigniert fest. Entsprechend switcht er in den Kung-Fu-Kenny-Modus und programmiert »DAMN.« zu seiner düstersten musikalischen Geschichte bis dato. Produktionen von Sounwave, DJ Dahi, Alchemist, 9th Wonder und Bekon werden diesmal nicht mit Neo-Soul-Keys und Jazz-Bläsern kandiert wie noch auf »TPAB«, sondern unter exekutiver Aufsicht von Mike-Will-Made-It ihrer Essenz überlassen. Nicht, dass sich Kendrick um seine Musikalität bringen würde: Mit Steve Lacy von The Internet entert man leiernden Psych-Indie à la Tame Impala, mit Badbadnotgood spielt man Beats rückwärts und zwinkert Anderson .Paak singend zu. Aber dann ist da eben auch Mike Will, der mit seiner G-Funk-Piano-Grobheit »HUMBLE.« und dem Halftime-Hit »DNA.« all jene Hörer abholt, die »Butterfly« abgehängt hatte. Plötzlich sieht man Mr. Duckworth im Studio neben seinen Label-Kollegen Schoolboy Q und Isaiah Rashad stehen, die sich die Freiheit rausnehmen, genau das zu tun, was dem TDE-Fackelträger zuletzt gefühlt verwehrt blieb: richtige Rap-Rap-Alben aufzunehmen. Was »DAMN.« zum großen Wurf macht, ist Kendricks gewachsene Fähigkeit, sich in rappender Gelassenheit zu üben – diesmal keine Gedichte und keine theatralischen Rollenspiel-Flows –, die trotzdem komplexe Erzählungen erlaubt: so wie das großartige »DUCKWORTH.«-Finale, das die Geschichte des bewaffneten Anthony »Top Dawg« Tiffith erzählt, der eine KFC-Filiale ausrauben will, in der Kendrick’s Dad, Ducky, arbeitet – sich dann aber dagegen entscheidet, als Ducky ihm ein paar Extra-Nuggets aufs Haus serviert. Ohne väterliche Großzügigkeit also kein Kenny; ohne kampflustigen Top Dawg wiederum heute kein GOAT. Allein an den zwei Herzen in Kendricks Brust, dem Zwiespalt zwischen Hype und Isolation, daran sind verdammt noch mal wir alle Schuld – jeder einzelne von uns. Also: ich habe nichts gesagt.
[amazon box=“B06Y4DGVZC“/]