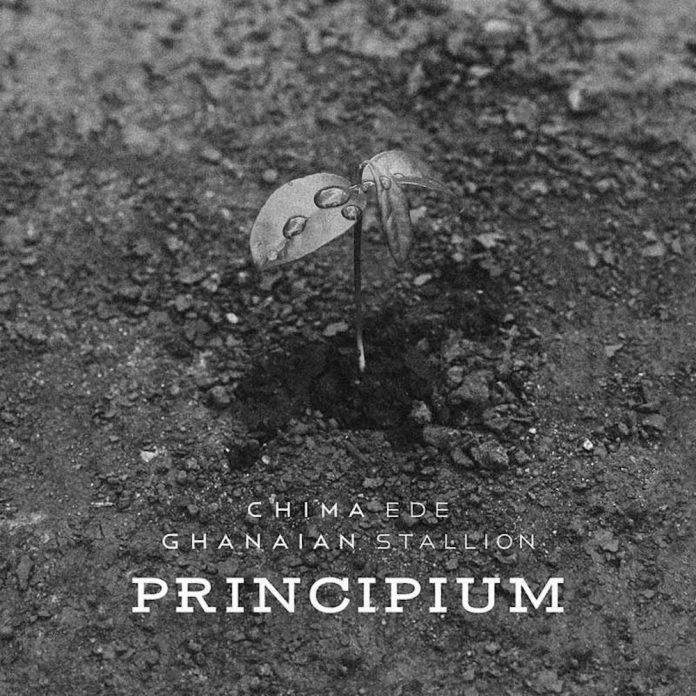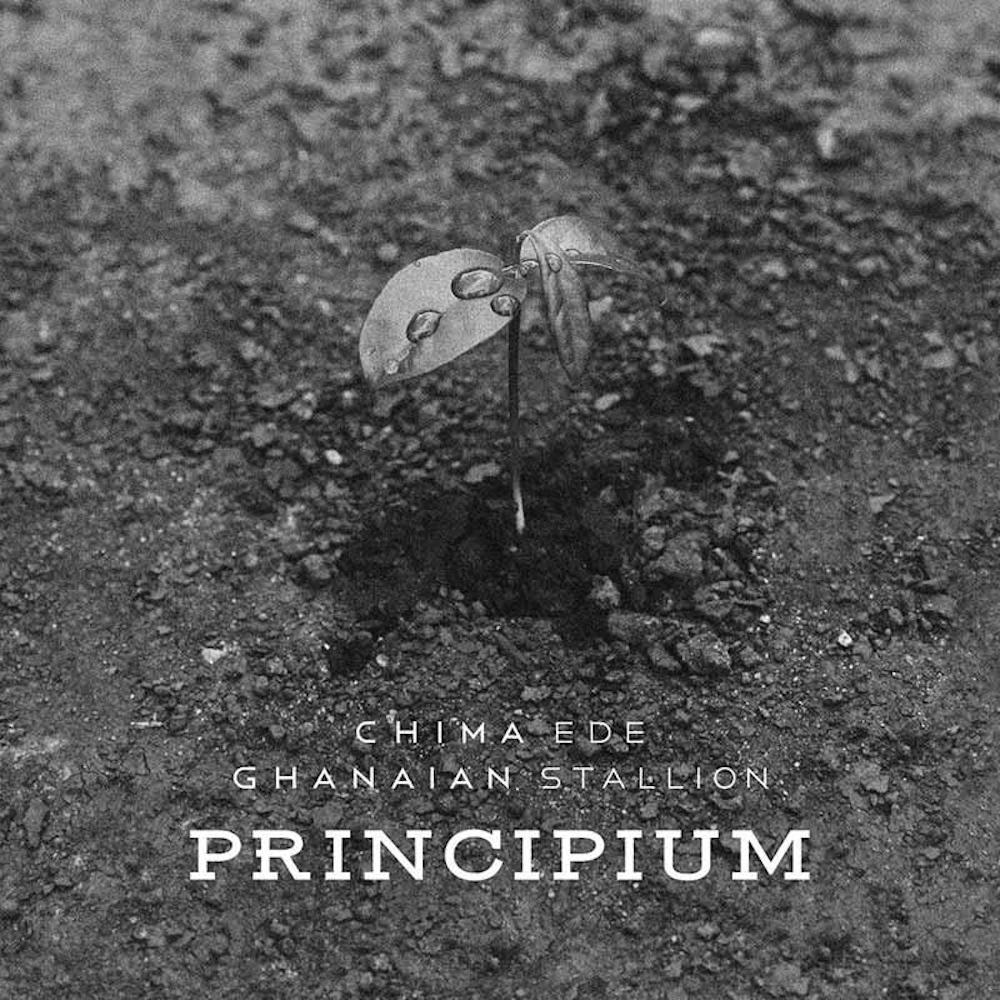
(soundcloud.com/chimaede)
Es dauert genau 13 Minuten, bis einem der Kloß im Hals stecken bleibt. Chima Ede hasst sich auf den Tod. Für das, was er seinen Eltern antat. Soll heißen: Planlosigkeit in Berlin, Ausloten vorschnell geschlossener Freundschaften und Überspielen von Orientierungslosigkeit mit Drogen – auf Kosten des Elternhauses, versteht sich. Nicht, dass Chima in der Generation Y damit eine Ausnahme wäre, im Gegenteil. Was den Wahl-Moabiter aber zumindest vom Rest seiner rappenden Mittäterschaft unterscheidet, ist die entwaffnende Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Nach zwei EPs ist »Principium« der dritte Output innerhalb eines guten Jahres – und das zwingendste Kapitel auf seinem »Weg ins Paradies durch innere Favelas«. Einmal mehr verwandelt der Mittzwanziger seine Ängste in Worte, und findet die Stärke in seinen Schwächen. Im Gegensatz zu rappenden Wohlstandsverwahrlosten, spart sich Chima die Münzen fürs Phrasenschwein und zeigt mit seinen persönlichen Geschichten konkrete Konflikte auf. Zum Beispiel, wenn er all seine Antipathie auf sich selbst richtet, weil er meint, seinen Vater enttäuscht zu haben – der einst vom afrikanischen Kontinent übersiedelte und das jugendliche Gealber seines Sohnes nun mit erarbeiteten Euros finanziert. Auch das Black-Power-Pamphlet »Jigidem« mit dem Moabiter Kollegen Musa kommt in seiner Kompromisslosigkeit nicht von ungefähr. Chima hegt zwei Vorlieben: lyrische Verschachtelung und technische Makellosigkeit. Verwebt er die miteinander, übersieht man glatt die gewaltige Portion Kitsch, mit der man es hier zu tun hat. Ja, Chima kann ein verdammtes Popschwein sein, das einem die Ohrwürmer nur so unterjubelt – und keiner kitzelte dieses Talent bis dato so heraus wie Produzent Ghanaian Stallion, der dem Rapper ein Amalgam aus trockenem Geknister und pathetischem Geklimper verpasst. Wenn man Chima Ede überhaupt noch etwas mit auf den Weg geben kann, dann den Rat, mit sich selbst nicht so hart ins Gericht zu gehen.