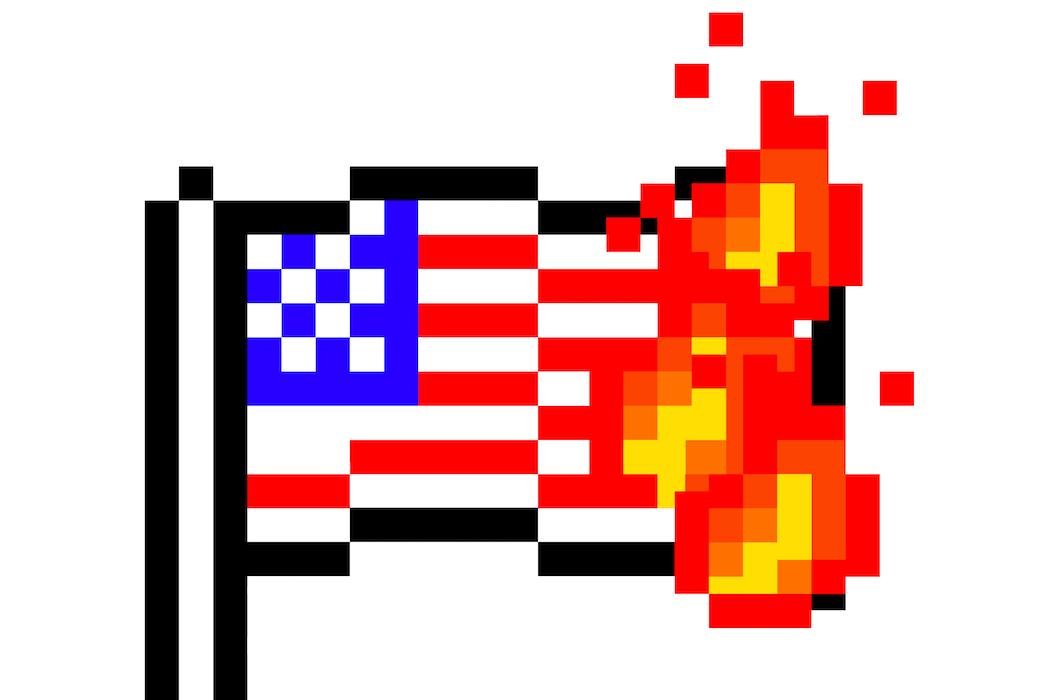
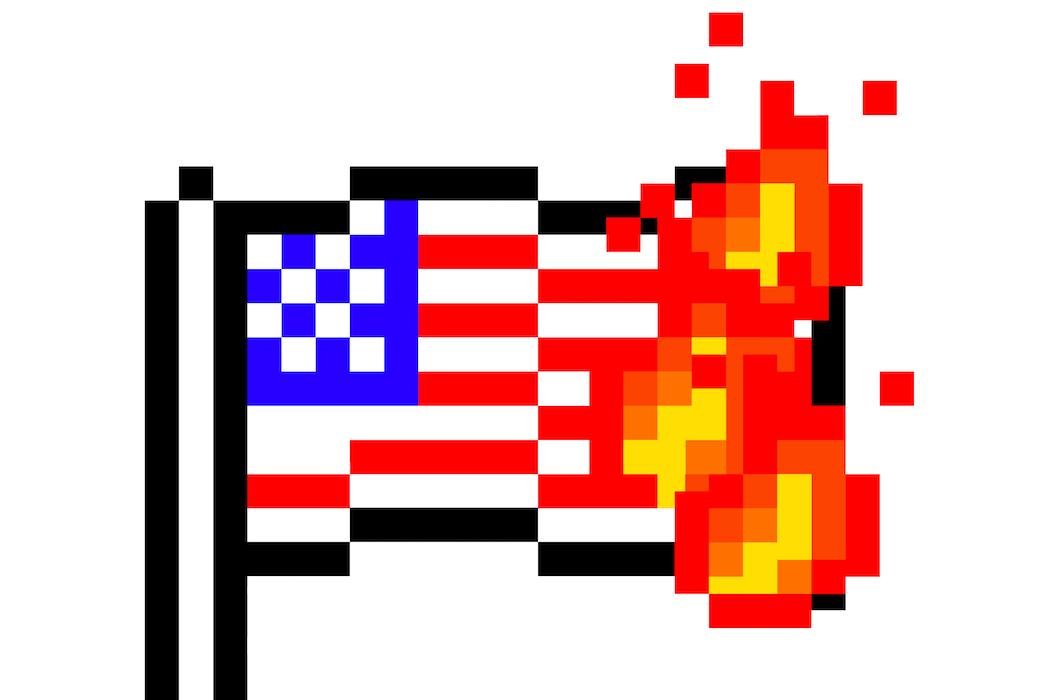
Die Welt ist am Arsch. Und auch, wenn diese Erkenntnis sicherlich keine neue ist, so ist sie uns doch lange nicht mehr so allgegenwärtig, furchteinflößend und bildgewaltig ins Bewusstsein geprügelt worden wie in diesen Tagen: Terroranschläge. Amokläufe. Polizeigewalt. Ausnahmezustände. Demokratiesterben. Rassismus. Die Liste ist länger als die Fressen, die wir alle ziehen werden, wenn Donald Trump am 8. November tatsächlich zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt werden sollte. Aber: Warum zum Teufel steht das in der JUICE? Nun, zum einen, weil die besorgniserregenden soziopolitischen Entwicklungen der jüngsten Zeit uns alle betreffen. Und zum anderen, weil Rapmusik einmal mehr eine Rolle dabei spielt – in Form von Motivationshymnen und Soundtracks von Demonstrationszügen, als musikalische Erklärungsmöglichkeit und gesellschaftskritische Bestandsaufnahme, als lauter Beobachter oder als unmissverständlicher Vermittler zwischen »denen da unten« und »denen da oben«. Um uns nicht allzu sehr im globalen Wirrwarr zu verfangen und es unnötig kompliziert zu machen, richten wir unseren Blick über den großen Teich, insbesondere auf die derzeitige Lage der US-Nation in Sachen #BlackLivesMatter – und darauf, welche Rolle Rap dabei spielt.
Das Zitat mit der darin enthaltenen Frage nach der politischen Richtung, die Amerika im Zuge der anstehenden Präsidentschaftswahlen dieser Tage einzuschlagen gedenkt, stammt aus dem Video zum Song »FDT« des kalifornischen Rappers YG. »FDT«, das steht für »Fuck Donald Trump«. Und Donald Trump wiederum, der steht für so ziemlich alle schwelenden Probleme, die sich unter der perfekt wirkenden Fassade des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten in jüngster Zeit Bahn gebrochen haben an seine kriselnde Oberfläche. Denn eins, das zeigen die aktuellen Entwicklungen mehr als deutlich, steht fest: Die unbegrenzten Möglichkeiten eines Landes, die schließen auch seinen potenziellen Niedergang mit ein. Also, Amerika: Wohin soll’s gehen?
YG jedenfalls, und viele andere Rapper auch, haben klar Stellung bezogen. Und zwar nicht nur gegen Donald Trump als Person, sondern auch gegen all das, was er verkörpert, wofür er steht: Dummheit, Ignoranz, Arroganz, Gier. Und Rassismus natürlich. Beispiel gefällig? Unter #buildthatwall hat Trump stolz und fest entschlossen erklärt, im Falle seiner Präsidentschaft an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen zu wollen. Wer dafür aufkommen soll? Die Mexikaner natürlich. Kompetenz in Sachen Einwanderungspolitik, how low can you go?
Und diese Situation um die schiere Eventualität, ein solcher Rechtspopulist wie Trump könnte möglicherweise bald »der mächtigste Mann der Welt« werden, die ist neu – für uns, aber auch für die USA selbst. Denn die Vereinigten Staaten galten, all den dortigen Problemen und sämtlichen Bush-Amtszeiten zum Trotz, stets als Stabilitätsgarant. Nun jedoch ist dieses Land, das den Westen führen sollte, selbst aus der Fassung geraten. Es ist gespalten und konfliktgeladen wie lange nicht mehr, und zwar gleich auf mehreren Ebenen: Bürger gegen den Staat, Demokraten gegen Republikaner, Arm gegen Reich, und – der Klassiker – Schwarz gegen Weiß. Es gibt kein Miteinander mehr, nur noch offene Konfrontation.
»Don’t let Donald Trump win, that nigga cancer.«
– YG
Aus Sicht der HipHop-Kultur ist dabei vor allem die Perspektive junger Afroamerikaner interessant, und die sind in erster Linie verbittert, aufgebracht, zornig. Klar, die Wut flammte immer, schließlich hat sich ihr Land noch nie besonders viel Mühe gemacht, ihnen nach der Sklaverei neben Drogen, Gewalt und Perspektivlosigkeit ein paar lebenswerte Alternativen zu bieten. Doch so lange sich diese Wut bloß gegen sie selbst richtete und lediglich in Black-On-Black-Crime maschinenpistolenmündete, sah sich das weiße Amerika nicht bedroht. Das ist nun anders, denn das schwarze Amerika hält seine Wut zwar nach wie vor auf den Streets, aber außerhalb ihrer abgeschotteten Wohnviertel; dort, wo sie wahrgenommen werden. Und begonnen hat alles am 9. August 2014.
An besagtem Datum erschoss der weiße Polizist Darren Wilson den 18-jährigen Afroamerikaner Michael Brown in Ferguson, Missouri. Der Schüler war unbewaffnet, lag nach seinem Tod noch vier Stunden in der Mitte des Canfield Drive herum, ohne dass Spuren gesichert wurden – ein trauriges Sinnbild für die anscheinende Gleichgültigkeit, die vom staatlichen Exekutivorgan bei der Aufklärung eines Mordes an einem schwarzen Jugendlichen an den Tag gelegt wird.
Seinem Tod folgten andauernde Unruhen und Demonstrationen gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt. Die Nationalgarde rückte aus. Nächtliche Ausgangssperren wurden verhängt. Nachdem eine Grand Jury zwei Wochen später beschloss, kein Verfahren gegen Wilson einzuleiten, kam es zu teilweise gewaltsamen Protesten – in mehr als 170 Städten der USA.
»Punk-ass cops, them crackers want us with our black off.«
– Schoolboy Q
Der Vorfall in Ferguson war weiß Gott nicht der erste dieser Art. Man denke nur an Rodney King, der 1991 von vier Polizisten brutal zusammengetreten und mit Schlagstöcken niedergeknüppelt wurde. Als die Officers ein Jahr später vom Vorwurf der Misshandlung freigesprochen wurden, löste die kollektive Empörung darüber bürgerkriegsähnliche Zustände in Los Angeles aus. Bilanz: 53 Tote, mehr als zweitausend Verletzte. Man fühlt sich direkt an die verheerenden Ausschreitungen beim Mordfreispruch im Falle Michael Browns erinnert. Ein Déjà-vu.
Und der Vorfall in Ferguson war weiß Gott nicht der letzte dieser Art. Doch er war derjenige, der traurige Ereignisse wie diese wieder auf die öffentliche Agenda brachte, und zwar weit über Stadt-, Staats- und Landesgrenzen hinaus. Und natürlich haben sich auch Rapper zu den Vorfällen von Ferguson zu Wort gemeldet. Und zu denen in Staten Island. Und Cleveland. Und North Charleston. Und Texas. Die Schüsse aus Polizeiwaffen haben direkt ins Herz des schwarzen Amerikas getroffen – und ziehen seither eine klebrige Blutspur durchs ganze Land.
Aber wie sahen die Reaktionen innerhalb der HipHop-Szene konkret aus? Nun, The Game beispielsweise trommelte für seinen Ferguson-Protest-Song »Don’t Shoot« direkt mal ein Who-is-Who an US-Rappern zusammen, darunter Rick Ross, 2 Chainz, Diddy und Wale. Game rappt: »They killin’ teens, they killin’ dreams.« J. Cole teilte seinen Tribute-Track »Be Free« über die gängigen Kanäle, »dedicated to Michael Brown and every young black man murdered in America«. Andere Rapper taten es ihnen gleich, viele brachten ihre Bestürzung über die Vorfälle zudem auf ihren Facebook- und Twitter-Seiten zum Ausdruck. MCs wie Talib Kweli und Killer Mike nahmen Stellung in Zeitungen und Nachrichtensendungen, Common rief während der Verleihung der MTV Video Music Awards 2014 gar zu einer Gedenkminute auf.
Doch als Rapper kommt man mit der musikalischen Verarbeitung solcher Vorfälle kaum hinterher. Nach einer aktuellen Studie der Menschenrechtsorganisation MXGM, wir in den USA alle 28 Stunden ein Afroamerikaner von einem Polizisten erschossen, mehr als dreihundert allein im letzten Jahr. »Still Nervous As Drivers/You see them lights get behind us/They pull me out for my priors/Won’t let me freeze ’fore they fire/You say that footage a liar«, beschreibt Schoolboy Q im Stück »Neva CHange« von seinem aktuellen Album »Blank Face LP« ein typisches Szenario: Am Ende einer polizeilichen Routinekontrolle müssen afroamerikanische Autofahrer immer häufiger umsteigen – in einen Leichenwagen. Trauriger Beleg für die anhaltende Aktualität dieser Zeilen: Zwei Tage, bevor die Platte veröffentlicht wurde, erschoss ein Officer den 32-jährigen Philando Castile, als der bei einer Polizeikontrolle seinen Führerschein vorzeigen wollte.
»Nigga, and we hate po-po/Wanna kill us dead in the streets fo’ sho’.«
– Kendrick Lamar
Auch der eingangs erwähnte YG findet auf seinem neuen Album »Still Brazy« nicht nur klare Schimpfworte in Richtung Donald Trump, sondern richtet seine verbalisierte Wut auch an den US-amerikanischen Polizeiapparat, dem er rassistisch motiviertes und staatlich toleriertes Töten von Seinesgleichen vorwirft. »Police Get Away Wit Murder« lautet der explizite Titel des letzten Albumtracks. Darin spricht er auch konkrete Mordfälle an: »Black males in a hoodie, that’s a target to them/They say he oversized and choked him out, that was harmless to them.« Damit bezieht er sich zum einen auf den Mord an Trayvon Martin, einem Highschool-Schüler aus Sanford, Florida. Der 17-Jährige trug den im Text erwähnten Hoodie, als er vom Nachbarschaftswachmann George Zimmermann erschossen wurde. Zimmermann landete zwar wegen Mordes vor Gericht, wurde ein Jahr später aber freigesprochen. Zum anderen greift YG den Mord an dem 43-jährigen New Yorker Eric Garner auf. Aufgrund des Verdachts, Garner würde unversteuerte Zigaretten verkaufen, wollten Cops ihn festnehmen. Als Garner sich wehrte, nahm ihn der Polizist Daniel Pantaleo in den Würgegriff und ließ auch nicht von ihm ab, als Garner mehrfach röchelte: »I can’t breathe.« Garner starb noch vor Ort an den Folgen dieser Misshandlung. Pantaleo, der schon Bürgerrechtsklagen am Hals hatte, weil er bereits in zwei anderen Fällen brutal und rassistisch motiviert vorgegangen war, kam straffrei davon.
Und von Vorfällen wie diesen gibt es viele. Zu viele. Hunderte. Und die jungen Schwarzen sind wütend – nicht mehr nur auf die Polizei, sondern auf ein Land, das sie einerseits nicht verstehen will, und das sie andererseits nicht schützt. Gemäß einer Aussage des Anwalts der Hinterbliebenen von Michael Brown, gehen 99 Prozent aller Cops, die den Tod eines Afroamerikaners herbeigeführt haben, straffrei aus. Und weil es Gerechtigkeit hinter den verschlossenen Türen der Gerichtbarkeit anscheinend nicht gibt, bringen die Menschen ihr Anliegen zum Thema »Polizeigewalt und Rassismus« nun seit Jahren schon auf die Straße. Überall im Land. Und jedes Mal werden es mehr. Sie skandieren: »No justice! No peace!«
»You’re fuckin’ evil, I want you to recognize that I’m a proud monkey!«
– Kendrick Lamar
Das Ganze ist zu einer Bewegung geworden, die unter #BlackLivesMatter 2013 im Internet als reine Selbstbehauptungsidee der schwarzen Community ihren Anfang nahm. Mittlerweile aber ist sie zu einem mächtigen Movement geworden, das ihre Anhänger regelmäßig von den Straßen in die Medien bringt. Denn dort haben die Beteiligten weitaus bessere Chancen, Gehör zu finden, als vor einem US-amerikanischen Richterpult.
Nicht mehr wegzudenkender Teil der »Black Lives Matter«-Bewegung ist auch Kendrick Lamar. Dessen Song »Alright« ist zur inoffiziellen Hoffnungshymne von BLM geworden, zum liedgewordenen Glauben daran, dass noch nicht alles verloren ist; daran, dass ein gemeinsames Aufbegehren eine Veränderung zum Guten bewirken kann: »We gon’ be alright.«
Überhaupt: Kendrick Lamar. Dessen hochgelobtes, hochintelligentes, hochpolitisches »To Pimp A Butterfly«-Album brachte Ende 2015/Anfang 2016 schwarzes Selbstbewusstsein zurück in den Diskurs um anhaltende Rassendiskriminierung. Die Platte war eine beeindruckende Standortbeschreibung afroamerikanischer Lebensrealität, ein vertonter Zeigefinger auf den prekären Umgang der USA mit seinen schwarzen Mitbürgern. Und weil die Songs zudem in einer solchen Dichte, mit einem solchen musikalischen Genius auf die Welt losgelassen wurden, konnte sich ihrer Botschaft auch außerhalb einschlägiger HipHop-Kreise kaum jemand entziehen. Auf der Platte rappt Kendrick über den richtigen Umgang mit dem schweren Erbe eines auf dem Rücken von Sklaven aufgebauten Industriestaats, über institutionellen Rassismus, Gang- und Polizeigewalt sowie rassifizierten Selbsthass. Über Letzteres sprach K-Dot kurz nach dem Tod von Michael Brown auch in einem aufsehenerregenden Interview mit dem Billboard Magazine, in dem er sagte: »I wish somebody would look in our neighborhood knowing that it’s already a situation, mentally, where it’s fucked up. What happened to Michael Brown should’ve never happened. Never.« Dann fügte er hinzu: »But when we don’t have respect for ourselves, how do we expect them to respect us? It starts from within.«
Für dieses Statement, in dem Kendrick der anhaltenden Diskussion um rassistisch motivierte Polizeigewalt die scheinbar schon längst aufgegebene Debatte um Black-On-Black-Crime entgegenstellt, hat er viel Kritik einstecken müssen. Am deutlichsten äußerte sich Rapperin Azealia Banks dazu, indem sie Kendricks Äußerung als »dumbest shit I’ve ever heard a black man say« vom Debattiertisch fegte. Die Frage ist, ab welchem Punkt man anfängt, die Diskussion zu führen. Denn dass die Entstehung der schwarzen und von Gewalt geprägten Viertel ein Resultat einer bewussten Segregationspolitik ist, die sich nur schwerlich ohne staatlichen Rassismus erklären lässt, dürfte wohl niemand ernsthaft in Frage stellen wollen. Dass es dennoch wünschenswert wäre, all der unbestrittenen Schwierigkeiten und der für Jungs aus der Hood misslichen Ausgangslage zum Trotz, afroamerikanische Jugendliche würden im Kampf um Selbstermächtigung und ein besseres Leben zu anderen Waffen greifen als zur Mac-10, ebenso. Aber aufgeben gilt nicht. »We gon’ be alright.«
»The police kill us so we made up our own laws.«
– Vince Staples
#BlackLivesMatter war und ist eine Bewegung, die zwar vehement, aber absolut friedlich gegen den nicht enden wollenden und unverhältnismäßigen Gewalteinsatz von Polizisten gegenüber Afroamerikanern eintritt. Doch abgesehen davon, das Thema weltumspannend auf die Agenda gebracht zu haben, hat sich nicht allzu viel verändert. Auch in diesem Jahr sind bereits mehr als 150 Schwarze den Kugeln aus Polizeiwaffen zum Opfer gefallen. Eine Zahl, die weiterhin wütend macht – und den 25-jährigen Ex-Soldaten Micah Johnson dazu gebracht hat, den Spieß umzudrehen. Am 7. Juli dieses Jahres eröffnete er in Dallas während einer Demonstration, die Teil der BLM-Bewegung war, das Feuer auf weiße Polizisten. Traurige Bilanz seines Attentats: Sieben verletzte Cops. Fünf tote.
Im Interview mit Complex hat sich Schoolboy Q unlängst ausführlich zur derzeitigen Lage um die anhaltende Gewalt zwischen weißen Polizisten und Afroamerikanern geäußert: »People are so fed up, they’re killing cops. People are starting to fight back. I don’t think killing is the way, but standing up for yourself is definetly important.« Wie gesagt: Bis dato war das dezentralisierte Netzwerk der #BlackLivesMatter-Bewegung absolut friedlich.
»I never vote for presidents, the presidents that change the hood is dead and green.«
– Vince Staples
»Ich bin traurig und enttäuscht von diesem Amerika. Wir sollten viel weiter sein. Wir sind es aber nicht.« Diese resignierten Worte wiederum stammen von Jay Z. Auch der hat Anfang Juli dieses Jahres mit der Veröffentlichung seines Songs »Spiritual«, dem ersten Solotrack seit drei Jahren, auf die Polizeigewalt gegen Schwarze reagiert, nachdem die beiden afroamerikanischen Familienväter Alton Sterling und Philando Castilo durch die Kugeln aus Polizeipistolen ums Leben gekommen sind. Jigga rappt: »I am not poison, just a boy from the hood that/Got my hands in the air/In despair don’t shoot, I just wanna do good.« Den Track hatte er bereits 2014 geschrieben, nach dem Tod von Michael Brown. Er hatte ihn damals aber noch zurückgehalten, denn er wusste: »Michaels Tod wird nicht der letzte sein.«
Im Remix zu seinem Song »THat Part« hat auch Q auf den Tod von Alton Sterling reagiert – ein Vorfall, der vor allem deshalb so viel mediales Aufsehen erregt hat, weil er von mehreren Menschen mit Handykameras festgehalten wurde. Dementsprechend richtet sich Schoolboys Unverständnis, seine Wut dieses Mal nicht allein auf die um sich schießenden Cops, sondern auch an die filmenden Zeugen dieser Morde. Und er findet deutliche Worte für sie: »When Alton Sterling gettin’ killed for nothin’/Two cowards in the car, they’re just there to film/Sayin #BlackLivesMatter, should’ve died with him.«
Das nicht enden wollende Dilemma, den sich ständig wiederholenden Teufelskreis anhaltender Polizeiübergriffe auf Afroamerikaner, hat Staples bereits letztes Jahr in einem Interview mit dem kalifornischen Lokalradiosender Power 106 kurz und knapp auf den Punkt gebracht: »Everybody fits the description.« Denn die Polizei hält letztlich immer nach ein und derselben Person Ausschau: jung, männlich, schwarz. Oder um Staples noch mal mit den Worten aus dem Track »Norf Norf« seines aufrüttelnden »Summertime ’06«-Albums zu zitieren: »I ain’t never ran from nothing but the police.«
»Most of us caught before we can expand our thoughts.«
– Schoolboy Q
»People are going through real serious issues right now«, hat Schoolboy Q vor kurzem zur Lage der US-Nation erklärt – und dem wird wohl niemand widersprechen, der in den letzten Wochen und Monaten ab und zu mal die Nachrichten verfolgt hat. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein zutiefst zerrüttetes Land, das zwischen Donald Trump und der Polizeigewalt gegen Schwarze dermaßen ins Schlingern geraten ist, dass noch nicht ganz klar ist, wie weit es dabei am Ende aus der Bahn geworfen wird.
HipHop und dessen Protagonisten jedenfalls nehmen ihren ursprünglichen Auftrag sehr ernst, alltägliche und unerträgliche afroamerikanische Lebensbedingungen konkret zu benennen; inhaltlich dort hinzugehen, wo es der schwarzen Seele weh tut, und ein ungeschöntes Bild all der Gegebenheiten zu zeichnen, die kein Bild sind – sondern bittere Realität. Nicht ohne Grund hat Kendrick Lamar im letzten Jahr zu Protokoll gegeben, er sei für die jungen Kids da draußen das, was einem Prediger am nächsten kommt – und das gilt für seine rappenden Kollegen wie Jay Z, YG, Schoolboy Q, Vince Staples & Co. gleichermaßen. Und warum? Weil sie den ganzen Irrsinn jeden Tag selbst am eigenen Leib erfahren und ihnen die Leute deshalb zuhören; weil sie unter denselben Umständen aufgewachsen sind und jeder einzelne von ihnen in seinem direkten Umfeld ebenfalls Opfer zu beklagen hat; weil sie gleichzeitig Kampfeswillen und Durchhaltevermögen vermitteln; und weil sie in ihrer Vorbildfunktion als erfolgreiche Rapper einen möglichen Ausweg aus der Misere aufzeigen, der zumindest noch einen kleinen Funken Hoffnung übrig lässt. Denn Rap ist zwar nach wie vor der ausgestreckte Mittelfinger einer ganzen Volksgruppe in Richtung ihrer Unterdrücker, aber der lässt sich eben auch auf die offene Schusswunde im Herzen Amerikas legen, um die Blutung zu stoppen. »We gon’ be alright.« ◘
Illustration: Jan Feindt


